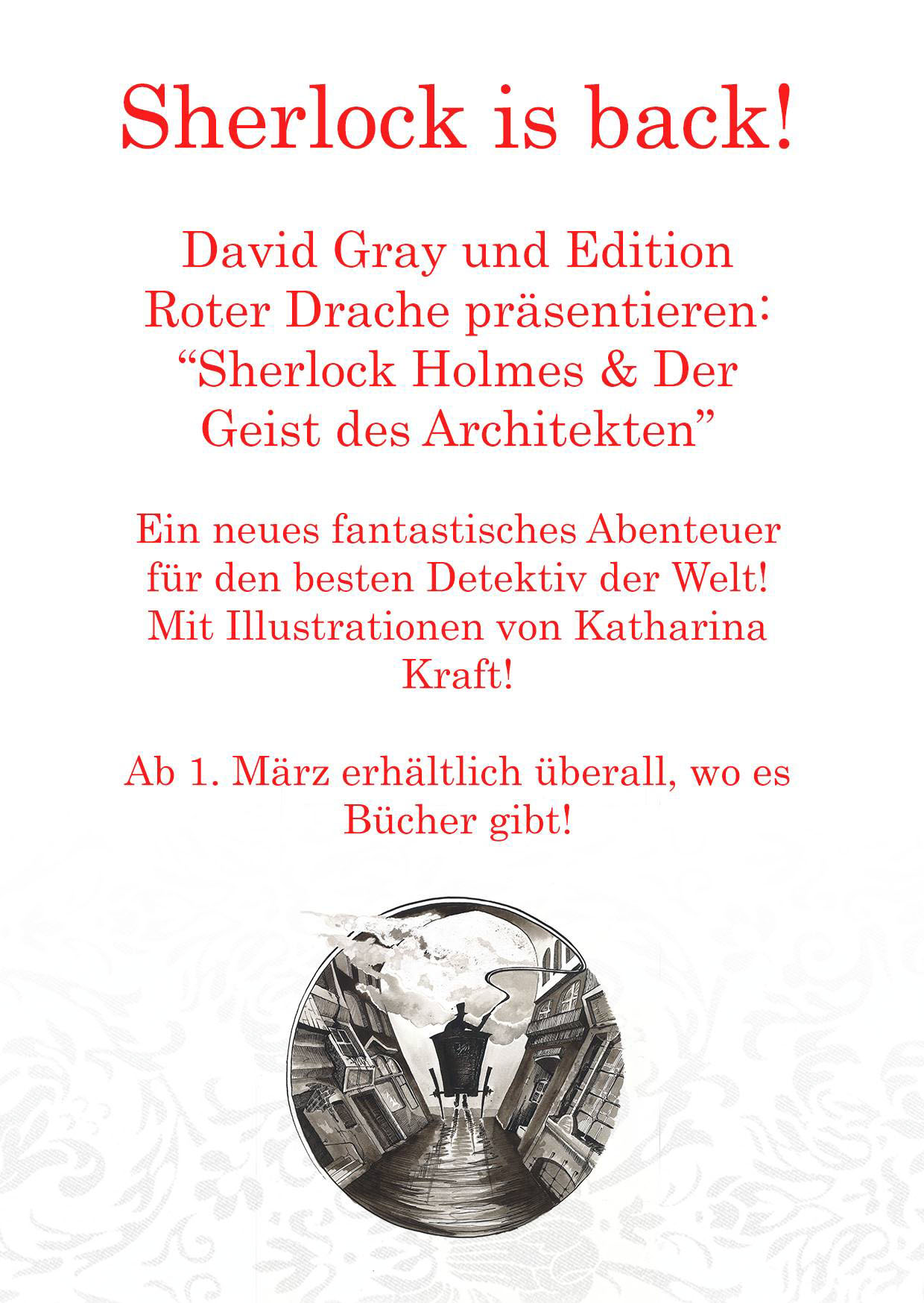Es ist kalt heute Morgen. Nicht nur draußen auf dem dunklen Pflaster, in den Straßen und Gassen, auf den Wegen zur Arbeit oder von der Arbeit, auf den frühen Einkaufswegen. Auch hier im Café ist es kalt. Mir frieren jagende Schauer durch den Körper und ich denke an den Sommer, verliere mich auf der „Walz“ durch trunkene Nächte, schläfrig durchwatete Tage, um weiter zu kommen, immer weiter ins nächste Paradies einer Lichtung, eines Ufers an einem rauschenden Fluss oder einem säuselnden Waldbach, wo ich mich niederlasse nach stundenlanger Wanderung und meine Plane spanne und mir ein Feuer mache und die Schnapsflasche aus dem Rucksack wühle, mein Büchlein hervor krame und das Gewesene eines warmen, sonnigen Tages aufschreibe, dabei trinke und an einer dürren Scheibe Brot kaue.
Im violetten Licht der sinkenden Sonne genieße ich die Paradiese, trinke mir die Fähigkeit einer wortlosen Liebe an, trinke mich in einen Rausch, wo Genießen und Lieben so maßlos sind, dass ich keinen Ausdruck finde.
Wahre Schönheit kannst du nicht in die engen Stuben einer Sprache zwingen. So ist es auch mit wahrem Genuss. Du kannst dem violetten Himmel ein ganzes Buch in der blumigsten Prosa widmen, aber du wirst es nicht schaffen, auch nur einen geringen Teil des Genusses wiederzugeben, der dich fühlen macht, dass du lebendig bist. LEBENDIG!
Die flimmernde Luft dieser farbigen Abende die du verstärkst mit deinem Schnaps, die tausend Geräusche und Millionen Gerüche, du wirst nie sagen können, was für ein Glück in diesen Momenten liegt. Nie, hörst du!
Und da lieg‘ ich unter dem großen Himmel der jetzt schwarz ist und bespritzt mit funkelnden Klecksen eines Pinselspiels der Götter, im Schein meines Feuers und satt selbst von dürrem Brot und trunken auch von billigem Fusel und schreibe und mein Schreiben ist der stumme Schrei, der mir aus dem Leib fällt, weil ich so lebendig bin, jetzt, hier, an diesem melancholischen Bach mit seinen leuchtenden Kieselsteinen und seinem Bett, in dem er nie schläft.
So ein Glück ist das, dass ich so schreien muss, um nicht im Genuss zu ersticken, um nicht im Druck dieser wohligsten aller Lebendigkeiten, auf weichem Waldboden, umgeben von hölzernen Riesen mit ihrer stummen Lebendigkeit, im Druck dieses glücklichen Rausches, in tausend Teile zu zerspringen.
Ich schreibe meinen Schrei und kann dir doch nicht sagen, welche Schönheit mich lebendig macht. Meine Worte sind nur Zehntel!
Und nichts, dass dich jetzt neben mir Platz nehmen lässt. Ach wärst du doch jetzt hier. Hier, mit mir, an meinem Feuer das unser Feuer ist, das brennt für mich und für dich. Ich gäb’ die Hälfte meines Brotes und die Hälfte meines Schnapses, ich gäb’ dir die Hälfte meiner Lebendigkeit und wäre doppelt lebendig, weil ich teilen kann. Weil du da wärst. Ja, du! Du, der du eben meinen Schrei hörst, so glücklich, so lebendig zu sein.
Und bald ginge rot die Sonne im Osten auf und würde uns wecken und wir würden -ein bisschen zerknittert- erwachen und uns die Nacht im klaren Bach abwaschen, die Schlafsäcke verstauen und den Schnaps, würden die Rucksäcke schnüren und aufbrechen ins nächste Paradies.
Und wir würden reden und schwärmen und schwitzen und laufen und uns ein Paradies suchen, oder ein Dorf mit einem kleinen Dorfladen, einem alten Krämer, der uns Brot verkauft und Schnaps und uns Wurst von gestern schenkt und guten Weg wünscht und froh ist, weil wir „Wandersleute“ sind wie er sagt, Leute, aus einer grau gewordenen Zeit, die es kaum noch gibt.
Und dann würden wir an Rainen entlang zum nächsten Paradies laufen und uns niederlassen und ein Feuer machen, das frische Brot kauen und Schnaps trinken und genießen, einfach nur die Lebendigkeit genießen und die Schönheit.
Und dann, wenn die Nacht gerade gekommen ist, wenn sich die warme Dunkelheit auf das Land gelegt und uns zugedeckt hat, dann würden stumme Blitze da hinten am Horizont zucken. Taktlos illuminierte Spiele.
„Wetterleuchten.“ –würdest du sagen und ich würde bloß nicken und lächeln und noch einen Schluck Schnaps trinken, dir die Flasche reichen und wir würden in den Himmel sehen, an dem die Wetterleuchten spielen und Wolken kommen, die in ihrem ebenso taktlos tanzenden Reigen die Sterne verdecken.
Ein Wind würde aufkommen. Ein sanftes Wehen erst, das dann stärker wird und stärker, dass die Glut unseres Feuers zerstiebt, die Flammen anfacht und kleine, glühende Spritzer in die schwarze Nacht jagt wie rotheiße Insekten im Paarungswettstreit eines euphorischen Triebes.
Ein übermütiger Regentropfen würde mit einem leisen Zischen auf dem kohlig weißglühenden Scheit verdampfen. Ein kleiner, einsamer Tropfen, vor gesandt, die Lage zu erkunden und sein schüchternes Dampfen ruft einen Bruder und noch einen und plötzlich würde ein Heer von Tropfen uns überfallen, als wollten die nassen Brüder und Schwestern den Tod des Spähers rächen.
Ein Zischen und Dampfen, Pochen und Klopfen würde losbrechen und wir würden eilig unsere Schlafsäcke unter die Plane zerren und uns unter ihrem schützenden Dach auf die Bäuche legen, den Kopf in die Hände stützen und dem Trommeln der Tropfen auf dem Kunststoffhimmel lauschen und dem Verdampfen der wütenden Brüder und Schwestern im Feuer zuhören, das nur noch ein kleines bisschen züngelt. Ein Krieg der Elemente. Kino im großen Glück der Lebendigkeit. Immer noch ist so Genuss!
Was ist ein warmer Sommerregen doch ein großes Schauspiel aller Schönheit Jetzt?!
So Wohlfühlen ist in diesem glückbringenden Schauer. Und der Schnaps schmeckt und die Kühle des Regens ist angenehm und die Wetterleuchten sind Blitze geworden. Blitze, die mächtig alles erhellen, Wege gehen, herab eilen auf der Suche nach Entladung. Und sie haben ihren grollenden Donner mitgebracht, der dumpf über unsere Köpfe rollt als rücken die Götter die hölzernen, schweren Betten zusammen um nahe beieinander zu liegen.
Aber du bist nicht hier. Ich muss das alles allein genießen.
Ich bin gezwungen, diese bezaubernde, unvergleichliche, alles umhüllende, prickelnde Schönheit allein zu genießen. Allein!
Ach wäre dieser Genuss doch nur teilbar. Genuss ist wohl das Einzige, was sich verdoppelt, sich verdrei- vervielfacht, wenn du es teilst.
Ich teile nur mit den Spinnen und Käfern, die sich unter meiner Plane in Sicherheit bringen. Und ich heiße sie willkommen und biete ihnen Brot an und Schnaps und rede mit ihnen und erzähle ihnen von meiner Sehnsucht nach einem Menschen, denn sie, die Spinnen und Käfer, antworten nicht. Stumm starren sie mich an, denn sie hören mir zu, die Spinnen und die Käfer. Sie sind gute Zuhörer. Aber sie sind auch schlechte Ratgeber für einen wie mich, der sie nicht versteht.
Und darum rede ich und rede, erzähle ihnen alles, was ich gerade weiß, erzähle ihnen vom Genuss und der grandiosen Lebendigkeit und biete ihnen noch einen Schluck Schnaps an und dabei fällt mir ein Satz von Françoise Villon ein: „Es ist kein Tier so klein, dass nicht dein Bruder könnte sein!“
„Prost meine Brüder und Schwestern!“ –sage ich und irre mich gewiss, als ich ihren Chor höre: „Prost, du Mensch! Du guter Mensch, der uns nicht verjagt und nach uns schlägt, uns zerdrückt und zertrampelt und der uns achtet und uns Obdach gibt, wo es doch so regnet gerade!“
Ich trinke noch einen Schluck und kriege gar nicht mit, dass es aufgehört hat, zu regnen. Von weit hinten, aus der Richtung, wo das Dorf verschlafen in seinem Tal liegt, mit seinem kleinen Laden und dem hutzeligen Krämer, dem freundlichen alten Mann in seinem gräulichen Kittel, der mir das Brot verkaufte und Wurst von gestern schenkte, heute Nachmittag, als wir beide bei ihm waren, von dort her grollt der müde Donner noch ein bisschen und wie ich einschlafe, ist alles still.
Ich erwache.
Es ist kalt geworden. Mir frieren jagende Schauer durch den Körper. Neben mir sitzt ein Bekannter und fragt, wie lang meine Pause eigentlich ist. Ich sehe auf die Uhr und erschrecke. Vor einer halben Stunde schon, hätte ich zurück auf Arbeit sein müssen.
Sechzig Minuten sitze ich schon hier, wandere durch sommerliche Wälder, schlafe in nächtlichen Regen, trinke und rede mit Spinnen und Käfern und dir, der du nicht da bist.
Die Pfeife in meinem Mundwinkel ist längst kalt. Der Tabak ein harter Klumpen grauer Asche. Und hier drin ist es kalt. Und draußen ist es kälter.
Ich bezahle, ziehe mir die Jacke über und mache mich auf den kurzen Weg, in der Hoffnung, mein Zuspätkommen wird nicht auffallen.