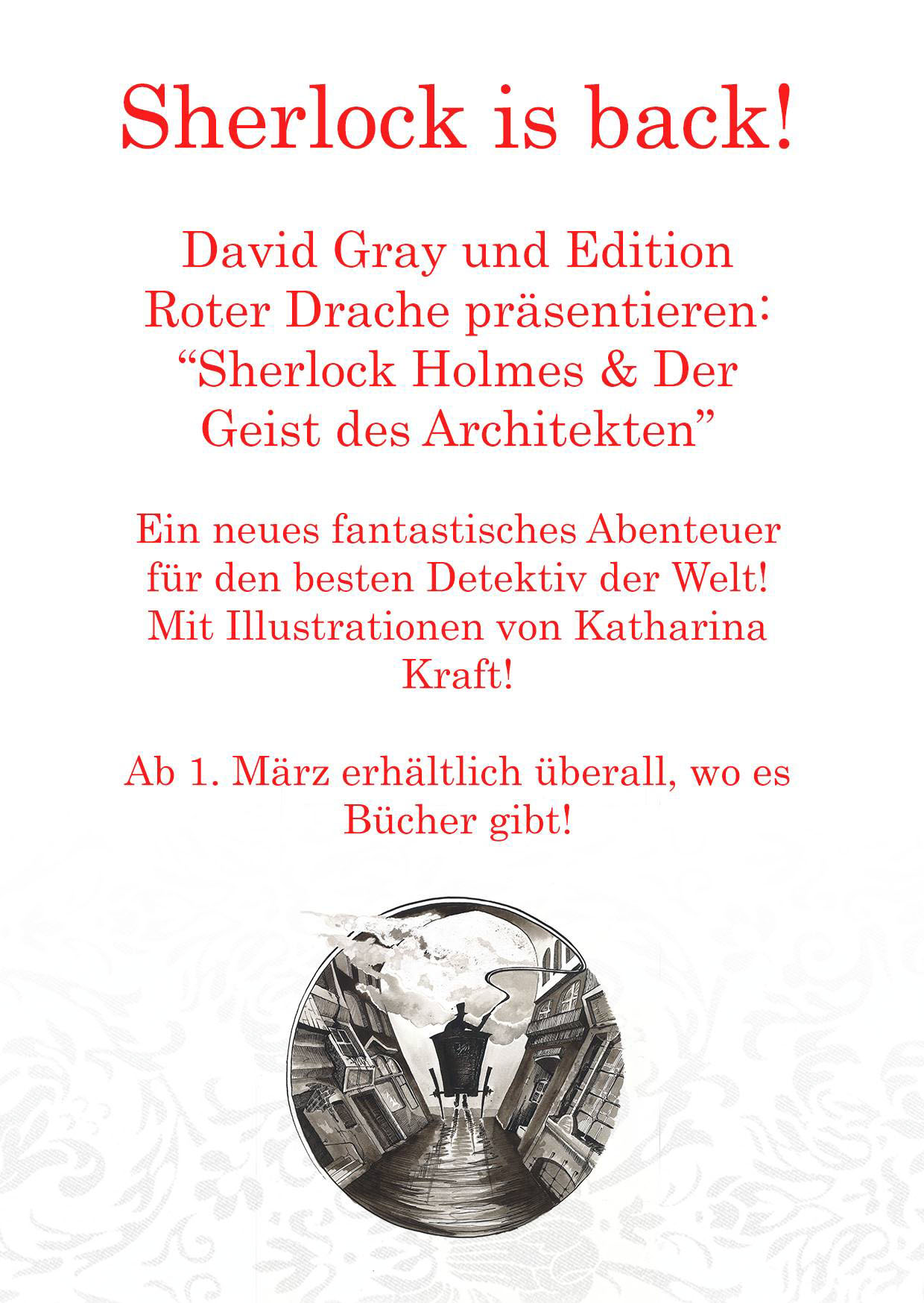Die Nächte explodieren in den Städten
Die Nächte explodieren in den Städten,
Wir sind zerfetzt vom wilden, heißen Licht,
Und unsre Nerven flattern, irre Fäden,
Im Pflasterwind, der aus den Rädern bricht.
In Kaffeehäusern brannten jähe Stimmen
Auf unsre Stirn und heizten jung das Blut.
Wir flammten schon. Und suchten leise zu verglimmen,
Weil wir noch furchtsam sind von eigner Glut.
– Ernst Wilhelm Lotz
I
Ich bin, das gestehe ich freimütig, ein Kind der Städte. Der Anblick individualtouristisch eroberter Natur gibt mir nichts. Ich bin kein Nordgesicht und habe keine Wolfshaut. Was interessiert mich der klare Quell, diese Vorstellung von Reinheit und Unbeflecktheit und ist es doch genau das, was diese zwei Prozent Hippieblut in mir suchten, als ich mich einst von den Häuserschluchten entfernte, um sie durch romantischere Abbilder zu ersetzen.
Auch schmutziges Wasser kann man trinken und die Quellen, die sich mir öffnen, sind manchmal nicht mehr als mündliche Überlieferungen aus tiefgefurchten Gesichtern an irgendwelchen Kneipentischen. An diesen Orten morastiger Gedanken, in diesen dämmrigen Bars voller zerbrochener Lebensentwürfe mit ihren unruhigen Blicken wie aus Wartesälen, an diesen geistigen Schutthallen tief im Gedärm der Städte, dem Rinnstein näher als dem Himmel, blühen keine blauen Blumen mehr, aber Landschaften sind immer auch Seelenlandschaften und ich sauge diese Fleurs du Mal, diese Oden des Verfalls in mich auf, weil mein Geist immer noch dürstet und doch keine andere Nahrung mehr verträgt.
Fragmentarisch erbrochene Lebensgeschichten auf Bierdeckeln am Morgen danach und ich lese in ihnen wie ein römischer Haruspex in den Eingeweiden von Opfertieren, weil ich den thoureauischen Wunsch verspüre, dem eigentlichen, wirklichen Leben näherzutreten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hatte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das leben, was nicht Leben war. Ich wollte das Leben in die Enge treiben und auf seine einfachste Formel reduzieren; wenn es sich gemein erwiese, dann wollte ich seiner ganzen unverfälschten Niedrigkeit auf den Grund kommen und sie der Welt verkünden. War es aber erhaben, so wollte ich dies durch eigene Erfahrung erkennen.
Ich beginne meine Betrachtungen bei einem Cuba Libre im Cafe Noir, nicht weil sich dieser Ort besser für den Prolog dieser Reise eignet als irgendein anderer, denn jede noch so kleine Straße und jeder noch so abgegriffene Tresen kann dich bis ans Ende der Welt führen, sondern aus dem einfachen Grund, weil man irgendwo beginnen muss und wenn es hier an diesem Ort nichts zu sagen gäbe, dann gäbe es woanders vielleicht auch nichts zu sagen. Denn was wir uns jenseits von Entertainment zu sagen haben, kommt doch aus uns und vermögen wir uns zu entfliehen, wenn wir die Schauplätze dieser menschlichen Tragikkomödie wie Kleidungsstücke der kosmopolitanen Modewelle anpassen?
Das Cafe Noir war ein in die Jahre gekommener Laden, der irgendwann in den späten 90ern mal ein florierender Nachtclub gewesen war, nun aber nur noch als Bar fungierte. Das gedämpfte Licht, die schweren Gardinen und die rotplüschigen Barhocker erinnerten noch an die Zeit, als junge Osteuropäerinnen hier den Gästen mit brüchigem französischen Akzent die Worte „Champus, mon cheri“ ins Ohr geflüsterten hatten, um dann kurz nach oben zu verschwinden, um ihnen in ausgelegenen Betten den Rest ihres Vermögens und noch einiges anderes aus der Hose zu ziehen.
Es war eine Bar mit einigen maulfaulen Trinkern, wie sie Edward Hopper wohl gefallen hätte, und man kann über Alex sagen, was man will und ich vermute, einige tun das auch, Stil hatte er, und als für seine Chefs die Achter klickten, übernahm er den Laden kurzerhand und verlegte den Geschäftsschwerpunkt mehr in die Vertikale.
Man kam also, trank seine Drinks, lauschte den ewig gleichen französischen Chansons, bestellte bei Andre eine Schachtel tonpapierumrandete Sobranie Black Russian mit Goldfilter, die ich noch nie zuvor und auch nie danach gesehen hatte, und ging wieder seiner Wege.
Manchmal hatte das was für sich.
Die Schachtel kostete zwar 10€, aber es war wirklich die einzige Sorte Zigaretten, die zu diesem Ambiente passen mochte. Irgendwie dekadent, kurz vorm Kitsch und mit einem ordentlichen Hauch Vanitas getränkt. Es waren merkwürdige Gedanken, die sich da so durch mich durchdachten, während ich in den mächtigen goldumrandeten Spiegel an der Stirnseite der Bar blickte und mir eine Sobranie nach der anderen ansteckte.
Ich dachte zum Beispiel: Junge, du bist jetzt 33 und weißt noch immer nicht, was du von diesem Leben zu halten hast und wohin du unterwegs bist. Komm mal zum Punkt. Irgendwann musst du dich entscheiden, du kannst nicht nur aus dem Zweifel heraus dein Leben gestalten. Irgendwann musst auch du mal ankommen.
Dieser Gedanke drängte sich zusammengerechnet mindestens eine Stange Sobranie lang durch mein Hirn. Damit war er mit umgerechnet 100 Euro einer der teuersten Gedanken, die ich so dachte und sein Wert ist immer noch beständig am Steigen.
Aber wo ankommen in dieser Zeit, wenn man für das kleine Glück nicht geschaffen und das Tiefere nicht mehr finden kann? Wenn man spürt, dass der ökonomische Drehbuchschreiber keine Rolle für dich vorgesehen hat, die dir behagt und alles andere in Oberflächlichkeit erstarrt. Gewiss, wir Argonauten der Apokalypse folgen einem altertümlichen Ideal, denn wir lesen lieber in Gesichtern, als auf Facebook und verbringen unsere Stunden lieber im Gespräch als auf einer virtuellen Farm in einem social game.
Und wo noch findet sich ein Schillern in den Augen des Gegenübers, um ein Gespräch plötzlich aus dem Meer der Banalitäten zu hieven? Wo wächst noch in Mitten zweier Eigenheiten plötzlich eine Insel der Kommunikation heran? Jahrtausende an nutzlosen Zivilisationserfahrungen in deinem hilflosen Hirn und der Mut ist so müde geworden und die Sehnsucht so groß. Es gibt keine Berge mehr, kaum einen Baum. Nichts wagt aufzustehen. Fremde Hütten hocken durstig an versumpften Brunnen. Nirgends ein Turm. Und immer das gleiche Bild. Man hat zwei Augen zuviel. Nur in der Nacht manchmal glaubt man den Weg zu kennen. Vielleicht kehren wir nächtens immer wieder das Stück zurück, das wir in der fremden Sonne mühsam gewonnen haben. Es kann sein, denkt etwas in dir, denn wir Nomaden der Städte haben versucht die Einsamkeit zwischen den wenigen Oasen zu kultivieren, ihr die Krallen zu stutzen, die uns einst ins Fleisch schnitten und unser Denken mit Bitterkeit tränkten, ja fast ertränkten. Staudämme an Gedanken, errichtet gegen das rasende Fluten der Aporie und fast schon sanft sickert nun ein melancholisches Rinnsal durch unsere Gedanken und ist uns vertrauter Gefährte geworden auf diesem Weg durch die Welt. Gewiss, das Leben stirbt sich nicht draus tot und nur noch manchmal, in manchen Nächten, liegt ein verzweifeltes „Eloi, eloi, lema sabachtani!“ auf unseren Lippen.
Und die Suche treibt dich weiter durch Straßen und Gassen, hinein in die schickeren Kneipen der Stadt. Gewiss es ist eine Suche ohne konkretes Ziel und du weißt, das Leben hat sich schon ein wenig an dir ausgetobt und links hast du Amalgam, rechts ein bisschen Gold aus besseren Zeiten im Gebiss und aus deinem Geist strahlt auch noch irgendwoher her hartnäckig eine aus erodierten edleren Idealen alchemisierte Legierung, die sich manchmal durch ein irres Flackern in deinen Augen bemerkbar macht und schon mehr dem Wahnsinn denn der Ratio den Weg leuchtet.
Und du merkst es an diesem unbefleckten Dr. Best-Lächeln in diesen Gesichtern, die das Leben fast konturenlos nur mit Pastellfarben gestreift hat. Ihre Themen werden nicht die deinen sein und Thommy Hilfiger und Ralph Lauren sind für dich nicht mehr als seltsame Namen, deren Mysterium sich dir nicht erschließt und du liest zwei Becks lang in Emersons „Von der Schönheit des Guten“ und der schreibt so hoffnungsvolle Sachen wie, „aber wohin uns das Leben auch treibt, urteilen wir nicht leichtfertig über den Wert und Unwert von Erfahrungen, denn wohin man und was man auch erfährt, es gibt nichts durch dessen Kenntnis wir nicht größer werden könnten, und sei es auch nur irgendeine Gassenweisheit, die wir auf der Straße aufgelesen haben“. Und als du später weiter durch die Straßen irrst, stolpert dir ein Penner mit seiner Bottle und einer dieser Weisheiten entgegen.
„Es schäumt!“, ruft er aufgeregt und zeigt auf seine überlaufende Flasche, während Xavier Naidoo von einer beleuchteten Plakatwand herunter der nächtlichen Stadt „Alles kann besser werden“ verspricht.
– Erschienen in „In Darkest Leipzig + Stadtapokalypsen“ Periplaneta 2014